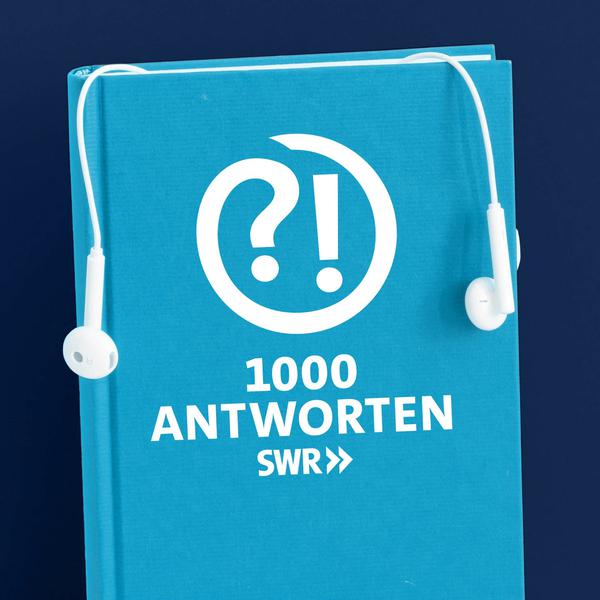
1000 Antworten
Südwestrundfunk
Woher stammt die "Quarantäne"? Wie entsteht ein Schwarzes Loch? Warum fallen Wolken nicht vom Himmel? Jeden Tag erklären wir hier ein kleines Stückchen Welt. | Texte unter http://1000-antworten.de
- 1 minute 24 secondsWas unterscheidet Intelligenz von Talent oder Begabung?
Intelligenz – eine Art geistige Flexibilität
Intelligenz ist eine allgemeine Fähigkeit, die uns in die Lage versetzt, Schlussfolgerungen zu ziehen – insbesondere, wenn es um akademisches Lernen geht . Das heißt:- aus bestehendem Wissen neues erschließen
- abstrakte Begriffe aus Einzelfällen aufbauen
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen bestimmten Begriffen sehen
Talent und Begabung beziehen sich auf bestimmte Bereiche
Talente und Begabungen beziehen sich im Gegensatz zur Intelligenz immer auf etwas: Jemand ist z.B. musikalisch begabt und kann Gitarre spielen.Intelligenz ist allgemein und breit angelegt
Intelligenz dagegen ist allgemeiner angelegt; man kann sie verschieden investieren. Wenn man intelligent ist, kann man besser Mathematik lernen – vorausgesetzt, der Unterricht ist gut. Man kann sich sprachlich besser ausdrücken usw. Intelligenz ist eine allgemeine "Kondition" – wenn man es auf das Sportliche bezieht – auf das Geistige bezogen.5 April 2025, 5:00 am - 3 minutes 8 secondsIst das Einrenken und Lösen von Blockaden im Rücken gefährlich?
Nur Fachleute an den Rücken lassen!
Wenn das Einrenken fachlich gut gemacht wird, also wenn derjenige eine chirotherapeutische Ausbildung hat, besteht nur ein geringes Risiko. Bei der Frage, wie häufig es gemacht werden darf, kommt es darauf an, warum in einer bestimmten Region immer wieder Blockierungen auftreten. Blockierungen können eben auch eine Reaktion auf verschiedene Veränderungen sein, beispielweise können entzündliche Veränderungen innerer Organe immer wieder Blockierungen hervorrufen. Dann ist es nicht ausreichend die Blockierung zu lösen, sie zu manipulieren. Man muss der Sache auf den Grund gehen, warum immer wieder diese Blockierungen auftreten. Wiederholte Manipulationen insbesondere im Halswirbelsäulenbereich können durchaus schaden. Diese wiederholten Manipulationen bedeuten Stress für die kleinen Wirbelgelenke; sie können "ausleiern".Unterschiede zwischen Männern und Frauen
Zu berücksichtigen ist auch, dass Frauen ein besonders weiches Bindegewebe haben und und in der Regel sehr viel mobiler sind als Männer. Bei besonders mobilen Patienten und Patientinnen kommt es vor, dass immer wieder Blockierungen auftreten. Dann ist es sinnvoll, dass man die Blockierung löst, aber auch die muskuläre Dysbalance behandelt und Ihnen insbesondere eine Muskelkräftigung verordnet.Blockierungen bei Muskelverkürzungen durch langes Sitzen
Die Kräftigung der Muskeln erfordert eine spezielle Krankengymnastik. Das ist deshalb wichtig, weil die Schultergürtelmuskulatur die besondere Eigenschaft hat, in Regionen zu verkürzen. Das heißt, durch Schreibtischtätigkeit kommt es zur Muskelverkürzung und in diesen Bereichen verkürzter Muskeln dann gehäuft zu Blockierungen. Daher ist es notwendig, die verkürzten Muskelgruppen zu dehnen. Da man nicht immer zum Krankengymnasten gehen kann, sollte man sich zwei, drei gute Übungen zeigen lassen, die man regelmäßig – im "Hausübungsprogramm" – durchführen kann, damit das Ganze auch einen Hafteffekt hat.4 April 2025, 2:00 pm - 1 minute 37 secondsWarum wurden manche Saurier so groß?
Sauropoden mit langem Schwanz und Hals
Richtig groß wurden hauptsächlich die Langhalsdinosaurier, die Sauropoden. Und das Größte an denen waren Schwanz und Hals. Der Rumpf selbst war nicht so wuchtig und massig. Außerdem waren die Knochen zum Teil mit Luft gefüllt; die waren also viel leichter.Vorteil: geringer Energieverbrauch
Der Vorteil der Größe liegt darin, dass ein großes Tier viel langsamer auskühlt. Und ein Tier, das keine Energie braucht, um seine Körpertemperatur zu halten, braucht viel weniger zu essen. Die Langhalsdinos standen also rum und haben einfach alles abgefressen, was der Hals erreicht hat. Mit nur einem Schritt erreichten sie wieder dieselbe Menge. Sie waren also sehr sparsam. Diese Gewichte waren für die Knochen ohne Weiteres tragbar, weil die schwersten Teile, nämlich die Wirbelsäule, luftgefüllt waren.2 April 2025, 4:00 am - 2 minutes 23 secondsWird auch das Meer nach unten immer wärmer?
Meerwasser wird nach unten immer kälter
Nein, nach unten hin wird das Wasser generell immer kälter. Das Meerwasser hat am Boden eine Temperatur von 2 Grad Celsius oder kälter. Es ist also anders als an Land, im festen Gestein. Das wird nach unten tatsächlich immer wärmer; man sagt: 3 Grad pro hundert Meter. Das ist im Meer nicht so, weil das Meer in Bewegung ist: Warmes Wasser ist leichter als kaltes und steigt auf, während kaltes Wasser absinkt. Das passiert ständig. Nehmen wir den Atlantik: Der Golfstrom transportiert warmes Wasser aus den Tropen Richtung Norden. Je weiter das Wasser Richtung Norden strömt, desto mehr kühlt es ab. Irgendwann ist es so kalt und dicht, dass es im Nordatlantik in die Tiefe sinkt. So haben wir insgesamt eine klare Schichtung im Meer: Oben ist das von der Sonne erwärmte warme Wasser. Und nach unten hin wird es immer kälter – zum Teil herrschen sogar Temperaturen unter Null.Wird das kalte Wasser am Meeresgrund zu Eis?
Nein, denn am Meeresgrund herrscht ein ziemlich hoher Druck und das Meerwasser ist salzig. Salzwasser hat einen niedrigeren Gefrierpunkt als Süßwasser, kann also im flüssigen Zustand kälter werden. Gerade im Bereich der Antarktis ist das Meerwasser zum Teil noch deutlich salziger als normal. Und je salziger es ist, desto schwerer ist es. Außerdem ist das Wasser sehr kalt, und weil es so salzig und kalt ist, ist es besonders schwer und sinkt an den Meeresgrund. Deshalb kann das Wasser am Meeresboden Temperaturen von 1 bis 2 Grad unter Null haben.Ausnahme: heiße Thermalquellen am Meeresgrund
Die einzige Ausnahme bilden die im weitesten Sinn vulkanischen Stellen des Erdbodens, wo heißes Gestein am Meeresboden austritt, oder bei den sogenannten Schwarzen Rauchern. Das sind Stellen, an denen aus dem Meeresboden aktiv kochend heißes mineralreiches Wasser austritt, also superheiße Thermalquellen. Die können 400 Grad heiß sein. Schwarze Raucher finden sich dort, wo der Meeresboden auseinanderreißt, also bei den Mittelozeanischen Rücken. Das sind aber nur punktuelle Zonen mit wärmerem Wasser.1 April 2025, 4:00 am - 1 minute 29 secondsWie lange braucht der Darm, um Schnitzel mit Pommes zu verdauen?
Bei fettem Essen dauert die Verdauung länger
Zunächst landen Schnitzel, Pommes und Mayo im Magen. Man würde sich also die Magenverweildauer ansehen. Die ist in der Tat für verschiedene Nahrungsmittel sehr unterschiedlich. Pommes und Mayo sind relativ fett; und je fetter etwas ist, desto länger liegt es im Magen. Es können in diesem Fall durchaus fünf bis sechs Stunden sein, die die Magensäure braucht, um die Vorarbeit zu leisten. Dann würde das Schnitzel mit den Pommes schon im etwas zerlegteren Zustand in den Dünndarm kommen. Im Dünndarm kommen Verdauungsenzyme aus Bauchspeicheldrüse, Leber und Galle dazu. Im Dünndarm können Sie noch mal mit etwa drei bis vier Stunden rechnen. Das ist auch sehr davon abhängig, wie schnell Ihre Darmperistaltik ist und ob es tagsüber passiert oder ob Sie bereits schlafen, denn nachts ist der Darm etwas langsamer.Nach acht bis neun Stunden kommt es wieder raus
Insgesamt sind Sie also mit etwa acht bis neun Stunden dabei. Das kann aber durchaus beschleunigt werden, wenn Sie zum Beispiel Reize von außen haben, die den Darm sehr stark stimulieren. Das heißt Aufregung oder auch Infekte oder gewisse Medikamente.31 March 2025, 4:00 am - 59 secondsWarum ist das Aprilwetter so wechselhaft?
Großräumige Zirkulation und großräumige Sonneneinstrahlung
Das liegt an der Umstellung des Wetters von der Winterzirkulation auf die Sommerzirkulation. Im Winter sind sowohl die See als auch das Land relativ kalt und es herrscht eine gewisse Beständigkeit. Wenn die Sonne im April höher steigt, erwärmt sich das Land stärker, während die Meere noch kalt sind. Es kommt zu einen Luftaufstieg über dem Land und es bildet sich eine neue Zirkulation.Viele Tiefdruckgebiete im April bringen Regen
Wir haben dann sehr viele Tiefdruckgebiete, die in rascher Folge über die Region hinwegziehen. Die bringen Regen; dann scheint wieder die Sonne und es ist warm. So kann man gerade im April die gesamte Palette aller Wettererscheinungen beobachten. Gründe sind also die großräumige Zirkulation und die großräumige Sonneneinstrahlung.30 March 2025, 4:00 am - 5 minutes 21 secondsWarum hat der Tag zwei mal zwölf Stunden?
12 Mondzyklen – 12 Monate
Hier stellt sich zunächst die Frage: Warum die Zahl 12? Dazu gibt es keine eindeutigen Antworten, aber viele Hinweise. Schon die frühen Astronomen erkannten: Nach 12 Mondzyklen wiederholen sich die Jahreszeiten. Deshalb hat das Jahr 12 Monate. Vielleicht steckte dahinter einfach der Gedanke, diese Zahl auf die Unterteilung des Tages zu übertragen. Die 12 ist außerdem eine unheimlich praktische Zahl. 12 Sachen lassen sich gut in brauchbare Portionen teilen: halbieren, dritteln, vierteln.Symbolträchtige Zahl in den alten Religionen
Möglicherweise spielt die Zahl deshalb in den alten Religionen eine so symbolträchtige Rolle: Sowohl die römische als auch die griechische Mythologie kennen jeweils 12 Hauptgötter. Die Bibel erzählt uns von 12 Stämmen Israels und von 12 Aposteln. Der schiitische Zweig des Islams geht von 12 Imamen als Nachfolger Mohammends aus. Wir kennen sogar ein eigenes Wort für eine Menge von 12 Dingen: Das Dutzend.Getrennte Welten: Tag und Nacht
Die 12 war also eine wichtige Zahl. Den Tag allerdings teilte man nicht in 12 Stunden ein, sondern in zweimal 12 Stunden. Warum nicht gleich 24? Das kommt aus einer Zeit, als für die Menschen Tag und Nacht noch getrennte Welten waren. Als es nachts wirklich dunkel war ohne künstliches Licht und sich das Leben vor allem tagsüber abspielte. Tagsüber konnte man die Zeit einigermaßen gut messen bzw. den Tag zeitlich strukturieren – nämlich mithilfe von Sonnenuhren.Altes Ägypten: 12 Sterne am Himmel im Verlauf der Nacht
Die Menschen fanden aber auch Möglichkeiten, die Nacht zu strukturieren: Vor über 4.000 Jahren haben Astronomen im alten Ägypten die Nacht in Stunden eingeteilt. Dafür haben sie für jede Zeit des Jahres am Nachthimmel 12 Sterne auserkoren, die verlässlich der Reihe nach auf- und untergingen. Ging der nächste Stern auf, brach eine neue "Nachtstunde" an.Die Stundengöttinnen
Das war auch religiös-mythologisch aufgeladen: Die Ägypter stellten sich dabei 12 Ruderer vor, die ein Boot mit dem Sonnengott Re durch die Unterwelt ziehen. Er muss 12 Tore passieren, 12 Bereiche durchqueren, 12 Gefahren überwinden. Für jedes dieser Tore stand eine Stundengöttin. Diese Sterne nannte man später Dekan-Sterne (deka = zehn), weil alle zehn Tage eine andere 12er-Gruppe diese Funktion übernahm. Über das Jahr waren es 47 Sternen bzw. Sterngruppen. Deshalb brauchte man aufwändige Tabellen, in denen man gucken konnte, welche Sterne gerade dran waren. Entscheidend ist: Es ging – nur dass das Messsystem nachts mit den Sternen ein komplett anderes war als tagsüber mit Sonnenuhren. Später gab es nicht nur für jede der 12 Nachtstunden eine Göttin, sondern auch 12 für den Tag.Älteste bekannte Sonnenuhr: eingeteilt in 12 Stunden
Auf der ältesten bekannten Sonnenuhr erkennt man bereits die Einteilung in 12 Stunden. Sie ist etwa 3.200 Jahre alt und wurde von Forschenden der Uni Basel im Tal der Könige in Ägypten ausgegraben. Der Überlieferung nach hatten die alten Griechen die Sonnenuhr mit den 12 Stunden von den Ägyptern und Babyloniern übernommen. Von dort ist sie dann ins Römische Reich gelangt und hat sich in Westeuropa ausgebreitet. Nun ist es so, dass die Tage im Sommer länger sind als im Winter. Trotzdem gab es am Anfang das Bedürfnis, den Tag analog zur Nacht immer in 12 Stunden einzuteilen. Das hatte zur Folge, dass im Sommer – wenn die Tage länger sind – auch die Stunden länger waren als im Winter. Diese je nach Jahreszeit unterschiedlichen Stunden nennt man auch "temporale Stunden". Damals waren tatsächlich Sonnenuhren in Gebrauch, die diese temporalen Stunden abbilden konnten. Man könnte meinen, das geht nicht: Die Sonne bewegt sich im Winter ja nicht schneller über den Himmel als im Sommer. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Schatten, den zum Beispiel ein Stab wirft, den man in die Erde steckt. Hängt man allerdings eine Sonnenuhr senkrecht an eine Wand, ändert sich der Schattenwinkel mit der Jahreszeit durchaus – und das kann man dann auch berücksichtigen. Also: Die 12 Stunden der Nacht wurden durch die Dekan-Sterne definiert. Die 12 variablen Stunden am Tag durch die temporalen Sonnenuhren.Erste mechanische Uhren im späten Mittelalter in Italien
Im späten Mittelalter, im 14. Jahrhundert, kamen in Italien die ersten mechanischen Uhren auf. Die funktionierten natürlich bei Tag und bei Nacht. Diese Uhren hatten noch keine Zeiger, sondern eine Glocke, die bei 1 Uhr einmal schlug, bei 2 Uhr zweimal und so weiter. Aber wo fing man mit dem Zählen an? Die italienische Zählweise, die auch in anderen europäischen Gebieten bis ins 17. Jahrhundert verbreitet war, begann mit Sonnenuntergang und zählte durch bis 24. Das war aber unpraktisch. Zum einen, weil man die Uhrzeit immer an den Sonnenstand anpassen musste. So konnte es passieren, dass im Winter die Mittagssonne um "4 Uhr" am höchsten stand, im Sommer um "8 Uhr". Zum anderen: Wer zählt schon 23 Glockenschläge, ohne sich zu verzählen?Technisch eleganteste Lösung setzt sich durch
Schließlich setzte sich die technisch eleganteste Lösung durch: Eine Uhr mit 12 gleich langen Stunden, bei der 12 Uhr mittags bzw. mitternachts ist. Da hängt die Uhrzeit dann nicht mehr von der Tageslänge ab. Weil die Technik einfacher ist, geht sie auch nicht so schnell kaputt. Und die "kleine Uhr" hatte noch einen sehr praktischen Vorteil: Es ist viel leichter, die Uhrzeit am Glockenschlag mitzuzählen, wenn es höchstens 12 mal bimmelt.29 March 2025, 5:00 am - 3 minutes 36 secondsWarum fließen Flüsse wie der Rhein auch in der Ebene schnell?
Rhein hat sehr geringes Gefälle
Steht man in Mannheim am Rhein, fließt der Fluss erstaunlich schnell an einem vorbei – immerhin mit 6 bis 7 km/h: Schneller als ein zügiger Fußgänger! Und das, obwohl es in der Rheinebene kaum wirklich bergab geht: Basel liegt 250 Meter über dem Meeresspiegel, von dort bis zur Rheinmündung sind es 1.000 Kilometer – so ergibt sich ein durchschnittliches Gefälle von 25 cm pro Kilometer. Das entspricht 0,025 Prozent – also fast nichts. Würden wir mit dem Fahrrad auf einer Straße mit so geringer Neigung fahren, würden wir von einem "Gefälle" nichts merken. Wir würden sie als ebene Fläche wahrnehmen und müssten ganz normal treten, um vorwärts zu kommen. Da ist nichts mit "rollen lassen".Reibungswiderstand ist im Wasser gering
Warum aber fließt dann der Fluss im Vergleich dazu so schnell? Intuitiv könnte man meinen: weil so viel Wasser von oben nachkommt und das Ganze anschiebt– aber das hat damit überhaupt nichts zu tun. Oder nur insofern, als natürlich, wenn ein Fluss sozusagen an einer Stelle stehen bleiben würde und von oben Wasser nachkommt, sich ein Wasserberg bilden würde. Dazu kommt es gar nicht erst, weil jeder Niveauunterschied an der Oberfläche sofort wieder ausgeglichen wird. Aber das hat nichts mit "Anschieben" zu tun, sondern mit dem geringen Reibungswiderstand im Wasser. Nochmal der Vergleich mit dem Fahrrad: Dass ein Reifen bei 0,025 Prozent Neigung nicht von alleine rollt, hat vor allem mit der Reibung zu tun. Die Reibung zwischen Reifen und Boden wirkt der Gravitation entgegen und verhindert bei sehr flachem Gefälle, dass man das Fahrrad einfach rollen lassen kann. Die Wassermoleküle dagegen üben gegenseitig einen viel geringeren Widerstand aus als ein Reifen auf Asphalt. Deshalb reicht schon eine geringe Neigung, um das Wasser abwärts fließen zu lassen. Trotzdem gibt es durchaus einen Zusammenhang zwischen Gefälle und Fließgeschwindigkeit. In den Alpen hat der Rhein ein starkes Gefälle – auf 400 Meter geht es im Schnitt einen Meter abwärts. Da fließt er schnell. Am Niederrhein dagegen beträgt das Gefälle nur ungefähr 1 Meter auf 8 Kilometer – dort fließt er langsamer. Am Oberrhein ist er an manchen Abschnitten steiler, an manchen flacher. Zum Beispiel hat der Rhein bei Mannheim, aber auch weiter flussabwärts bei Koblenz, ein steileres Gefälle als dazwischen im Rheingau. Und entsprechend schnell oder langsam fließt der Fluss jeweils.Wasser fließt in der Flussmitte schneller
Aber wenn man so am Flussufer steht, sieht man auch: Der Fluss bewegt sich in der Mitte schneller vorwärts als am Rand – denn am Ufer wird das Wasser wiederum durch die Reibung und durch Verwirbelungen gebremst. Kurz: Je weiter weg vom Ufer und je tiefer das Flussbett, desto schneller fließt das Wasser. Aus demselben Grund fließt ein Fluss bei Hochwasser auch schneller als bei Niedrigwasser, denn bei Hochwasser liegt das Flussbett noch tiefer. Danke an: Matthias Adler, Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz29 March 2025, 4:00 am - 3 minutes 13 secondsWarum sind Spaghetti so lang?
Darreichungsform "dünner Faden"
Weil es sonst keine Spaghetti wären! Spaghetti ist der Plural von Spaghetto. Das wiederum ist eine Verkleinerungsform von Spago, was "dünner Faden" bedeutet. Daneben gibt es für Nudeln viele weitere Darreichungsformen: Rigatoni, Maccheroni, Spinelli, Fettuccine, Farfalle usw. Die lange, fadenförmige Variante hat man Spaghetti genannt.Spaghetti – Inbegriff der Nudel
Trotzdem ist es eine berechtigte Frage, warum ausgerechnet diese Variante zum Inbegriff aller Pasta-Speisen geworden ist. Es ist auf jeden Fall die Variante, die Kinder als erstes kennenlernen. Ich kenne kein Kind, das als sein Lieblingsessen Rigatoni nennt. Aber ich habe eine Menge Kinder kennengelernt, die von Spaghetti schwärmen. Warum nun also ausgerechnet Spaghetti? Das hängt sicher damit zusammen, dass die Fadenform bei der Herstellung ziemlich praktisch ist. In dieser langen dünnen Form trocknet der Teig nämlich schnell. Das war früher noch wichtiger als heute, denn den getrockneten Teig konnte man lange aufbewahren – und Spaghetti halten sich bekanntlich lange.Historische Belege aus dem 12. Jahrhundert
Die langen Nudeln tauchen bereits ab dem 12. Jahrhundert in historischen Quellen auf, insbesondere in einem Bericht des arabischen Geografen al-Idrisi (um 1100 - 1166). Der hat damals Sizilien bereist und hielt es für berichtenswert, dass in Trabia – einem Ort östlich von Palermo – solche langen getrockneten Nudeln nicht nur hergestellt, sondern auch exportiert wurden. al-Idrisi dokumentierte die Existenz dieser Speise also, noch bevor Marco Polo (1254 - 1324) nach China reiste – und dort ebenfalls mit der langen Nudel konfrontiert wurde. Die Chinesen stellten ja ebenfalls lange Nudeln her, allerdings vermutlich aus Reismehl oder zumindest einem Reis-Weizen-Gemisch. Die waren aus dem gleichen Grund lang und dünn: Man konnte sie mithilfe einer Presse einfach herstellen und schnell trocknen. Insofern haben die langen dünnen Spaghetti einfach Tradition; im Handel gibt es sogar eine extralange Variante. Trotzdem: Tradition rechtfertigt nicht alles, und bei den heutigen Produktionstechniken spielen diese Form-Vorteile der Spaghetti keine große Rolle mehr. Vielleicht ist heute also eher die Lagerung von Bedeutung: Spaghetti lassen sich dichter packen als Rigatoni oder Spinelli und beanspruchen daher weniger Platz im Regal oder im Transporter.Kleckeralarm!
Richtig ist: Beim Essen stellen die langen Nudeln eine gewisse Gefahr dar, genauer: Die Nudeln in Kombination mit farbenfrohen Soßen. Doch wären kürzere Spaghetti wirklich praktischer? Die lange Form hat immerhin den Vorteil, dass man sie gut um die Gabel wickeln kann und sie dort auch bleiben. Mit kürzeren – zum Beispiel halbierten oder geviertelten Spaghetti – geht das nicht mehr so leicht; die fallen dann eher mal runter. Insofern ist eine gewisse Mindestlänge schon sinnvoll. Wir halten fest: Andere Pasta-Formen, die sich aufspießen lassen – wie eben Rigatoni – sind für weiße Hemden die sicherere Variante. Aber dann sind es eben keine Spaghetti mehr.28 March 2025, 9:00 am - 1 minute 48 secondsWo hat der Aprilscherz seinen Ursprung?
Geburtstag von Judas als Erklärung
Für die Scherze am 1. April gibt es unterschiedliche Erklärungen. Die meist genannte ist die, dass im April der Geburtstag des Judas sei. Und weil Judas so unverlässlich gewesen sei und Christus verraten habe, würde man die Leute am 1. April auch täuschen. Ob das eine wirklich stichhaltige Erklärung ist, weiß ich nicht.Monat April: unzuverlässig wie das Aprilwetter
Wir schicken die Leute auch nicht zuletzt deswegen in den April, weil der April so ein wenig verlässlicher Monat ist; das Wetter ist überhaupt nicht vorhersehbar.Marzo pazzo: In Italien ist es der verrückte März
In Italien übrigens ist die ganze Geschichte rein meteorologisch einen Monat früher. Die Italiener sagen Marzo pazzo dazu. Dort ist der März so wechselhaft, und die Italiener feiern in besonderer Weise den 1. März. Vor allem aber feiert man das zum Beispiel im Engadin. Nicht so, dass man jemanden in den März schickt, sondern man erinnert an den altrömischen Jahresbeginn. Das altrömische Jahr hat nämlich im März begonnen, am 1. März. Der Kriegsgott Mars war ja auch der Schutzpatron Roms; deswegen begann dort das Jahr.28 March 2025, 5:00 am - 1 minute 22 secondsWoher kommt der Ausdruck "toi, toi, toi"?
Apotropäische Handlung: sich mit Spucke den Teufel vom Leib halten
Man spuckte aus, wenn man Dämonen und ungute Einflüsse abwenden wollte. Und noch besser war es natürlich, wenn man dreimal ausgespuckt hat. Also sagen wir, jemand hat zu jemandem gesagt: "Du, hoffentlich fällst du nicht vom Pferd!“ – Und dann hat der gesagt: "Na, hoffentlich nicht!“ – und hat dreimal ausgespuckt.Onomatopoeia – Lautmalerei
Jetzt stellen Sie sich vor, unter Bürgern war sowas natürlich ganz unmöglich, man kann ja nicht dreimal ausspucken. Also hat man etwas gemacht, was mein Vater auch noch tat: Er hat ein Spuckgeräusch gemacht, nämlich: t, t, t. Das klingt fast wie toi, toi, toi. Es handelt sich hierbei um Onomatopoeia, also um einen lautmalerischen Ausdruck. Das "Toi, toi, toi“ ist eine Hüllformel für das Ausspucken. Und das dreimalige Ausspucken soll bedeuten: Kein Unglück! – Und im Umkehrschluss dann eben: Viel Glück wünsche ich Ihnen natürlich auch.27 March 2025, 2:00 pm - More Episodes? Get the App